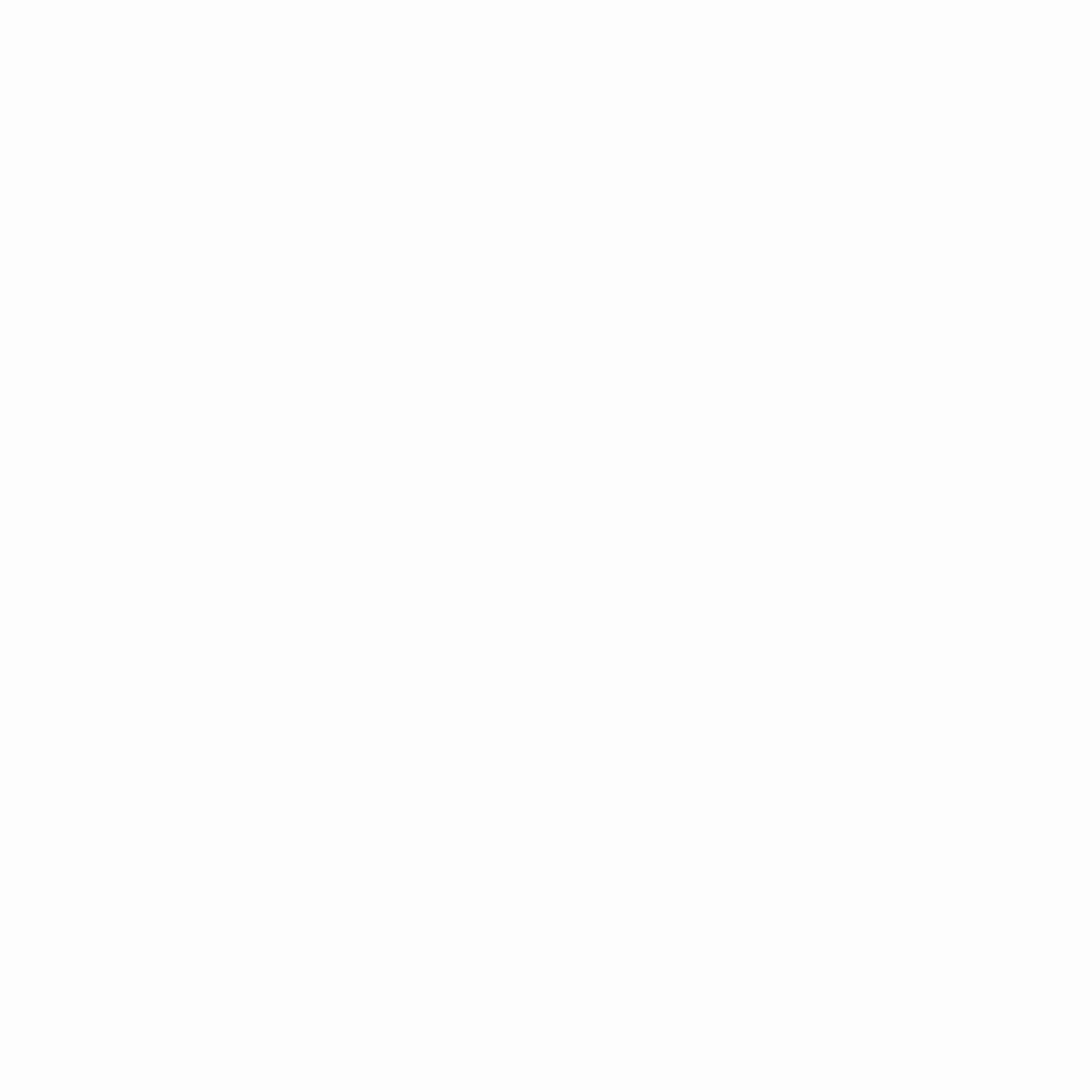Ein Kommentar:
Nur ein Jahr nach dem Ende ihrer popkulturdefinierenden Tour hat Taylor Swift vergangenen Freitag ihr zwölftes Studio-Album „The Life of a Showgirl” veröffentlicht. Das Album bietet einen Einblick hinter die glitzernden Kulissen einer Prominenten und stellt die Frage, ob die Folgen des Ruhms es wert waren, ihre Wünsche erfüllt zu haben. Aber vor allem geht es in diesem Album um Liebe. Die Liebe für all die großen Frauen, die Taylor bewundert. Die Liebe, die sich selbst in obsessivem Hass finden lässt. Die Liebe zwischen unserer Protagonistin und ihrem Seelenverwandten, von dessen Glied wir in einem Song viel zu viel hören.
Als Fans, die sich Swifties nennen, ihren ersten Blick auf die Titelliste warfen, herrschte innerhalb der Community große Verwirrung um das Lied „Wood”. Es war ein so seltsamer Titel für einen Song, der ihrer Ansicht nach nur eine sexuelle Bedeutung haben konnte (1). Oder vielleicht doch nicht? Einige Leute spekulierten, dass der Name sich auf das Märchen „Pinocchio“ beziehen könnte, da auf dem Regal hinter Swift und ihrem Verlobten ein hölzerner Puppenjunge zu sehen war, als die beiden ursprünglich das Album ankündigten (2). Andere wiederum vermuteten, dass der Name sich auf die Schauspielerin „Natalie Wood“ beziehe, deren Privatleben von der Presse auseinander genommen wurde und deren Lebensgeschichte demnach relevant für die Kernthemen des Albums sein könnte (3).
Unglücklicherweise stellte sich heraus, dass die Fans ganz am Anfang recht hatten. In dem Lied „Wood” geht es um Sex und wie riesig der Penis des Partners des lyrischen Ichs ist. Was womöglich okay wäre, wenn die betroffenen Texte gut geschrieben wären. Aber die Lyrics, für die Swift in ihren letzten vier Studioalben gefeiert wurde, enttäuschen in diesem Fall maßgeblich: „He dickmatized me […] Redwood tree, it ain’t hard to see” / „Er hat mich dummbegeistert […] Mammutbaum, es ist nicht schwer zu erkennen”
Ein weiteres negatives Beispiel kommt von einem Song, der bis auf die folgenden Kritikpunkte meines Erachtens eigentlich ziemlich gut ist. Nämlich „CANCELLED!”, in dem Swift ein Meme aus dem Internet zitiert: „Did you girlboss too close to the sun?” / „Warst du zu nah an der Sonne Girlboss?” (4). Jegliche Referenz auf die schnelllebige Internetkultur droht sowieso schon nach kurzer Zeit steinalt zu wirken, aber in diesem Fall war das Meme schon geschmolzener Schnee von vorgestern. Das Meme vermittelt leichtsinniges, feminines Verhalten, was in diesem Lied durch eine andere Formulierung hätte behandelt werden können.
Die Kunst des Schreibens besteht darin, die richtigen Worte zu wählen, um komplexe Gefühle auszudrücken, die der durchschnittliche Mensch nur schwer erklären kann. Es ist etwas, das Swift selbst zuvor in diversen Songs getan hat. Aber hier schafft sie das an vielen Stellen einfach nicht. Nicht mal bei Themen, die sie in anderen Liedern bereits behandelt hat. Der absolut schlimmste Fall hiervon ist „Eldest Daughter”, ein Song, der vieles versucht. Unter anderem darzustellen, dass die harte Welt des Internets nicht der richtige Ort ist für jemanden wie das lyrische Ich. Die Liedtexte vermitteln dies, indem sie es einfach trocken ausdrücken, wie man es in einem Gespräch tun würde:
„Everybody’s so punk on the internet. Everyone’s unbothered ’til they’re not. Every joke’s just trolling and memes. Sad as it seems, apathy is hot […] Every hot take is cold as ice. […] But I’m not a bad bitch. And this isn’t savage. But I’m never gonna let you down.” / „Jeder ist so punk im Internet. Jedem ist alles egal, bis es das nicht ist. Jeder Witz ist ein Troll und Meme. So traurig wie es scheint, Apathie ist heiß […] Jede heiße Haltung ist kalt wie Eis. […] Aber ich bin keine Bad Bitch und das ist nicht wild. Aber ich werde dich nie im Stich lassen.” Verglichen mit ähnlichen Zeilen aus „The Lakes“ aus ihrem 2020er Album „Folklore“ fällt auf, dass sie dort mit viel weniger Worten deutlich mehr aussagt und dies auch wesentlich eleganter tut: „I’m not cut out for all these cynical clones. These hunters with cell phones […] Take me to the lakes, where all the poets went to die. I don’t belong, and my beloved, neither do you.” / „Ich bin nicht geschaffen für all diese zynischen Klone. Diese Jäger mit Handys. […] Nimm mich mit zu den Seen, wohin alle Dichtenden zum Sterben hingingen. Ich gehöre nicht hierhin und mein Geliebter, du auch nicht.” Erschwert wird der Schmerz dadurch, dass „Eldest Daughter” kein Ohrwurm ist. Da es ein Track 5 ist (welcher bei Swift in der Regel gefühlvolle Balladen sind, die richtig ins Herz treffen), hat er eine sehr langsame Melodie. Demnach gibt es hier nichts, was von diesen Lyrics ablenken oder anderweitig Abhilfe schaffen kann.
Aber während die Texte aus ihrem letzten Projekt „The Turtured Poets Department“ eine poetischere Wortwahl haben, leidet das Album darunter, dass der Klang jedes zweiten Liedes zum Verwechseln ähnlich ist. In dieser Hinsicht ist es ziemlich interessant, wie „The Life of a Showgirl” das komplette Gegenteil ist. Klanglich zeigt das neueste Album nämlich eine große Verbesserung. Dieser Wandel lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass Swift sich statt für ihren langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff für Max Martin als Produzenten entschied (5). Allerdings ist Martin für Fans kein neues Gesicht. Als Produzent der Pop-Bibel „1989” und „Reputation” prägte er den Klang von Swifts 2010er Hits (5). Diese Zusammenarbeit erklärt auch, wieso viele der Lieder auf „The Life of a Showgirl” zu diesem alten Pop-Sound zurückkehren.
Der erste Song „The Fate of Ophelia” zum Beispiel ist unfassbar catchy. Mit einem Refrain, der lange nach dem Ende im Kopf bleibt, erschafft der Opener eine ansteckend gute Laune. „Elizabeth Taylor” ist ebenfalls ein Ohrwurm, hat aber auch einen großartigen Beat-Drop. Die Melodie klingt teuer, was zu dem luxuriösen Leben passt, das Swift uns mit ihren Worten ausmalt: „That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athénée. Ooh-ooh, oftentimes it doesn’t feel so glamorous to be me. All the right guys promised they’d stay. Under bright lights, they withered away, but you bloom.” / „Dieser Ausblick von Portofino ging mir durch den Kopf, als du mich am Plaza Athénée angerufen hast. Uh-uh, oft fühlt es sich gar nicht so glamourös an, ich zu sein. All die richtigen Männer versprachen, zu bleiben. Unter grellen Lichtern verwelkten sie, aber du blühst auf.”
„Actually Romantic” ist ein weiteres Sternchen, das seine Zeit im Rampenlicht verdient. Eine scharfe Kante, die sowohl mitreißt als auch provoziert: „I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave […] Stop talking dirty to me. It sounded nasty, but it feels like you’re flirting with me” / „Ich hab gehört, wie du mich ‘langweilige Barbie’ genannt hast, als du dich auf Koks mutig gefühlt hast […] Ach, hör auf so schmutzig mit mir zu reden. Es klingt gehässig, aber es fühlt sich an, als würdest du mit mir flirten.” Trotz einigen schwierigen Zeilen kann ich dem Song „CANCELLED!” das gleiche Lob zusprechen. Energisch und boshaft innerhalb eines genießbaren Maßes: „It’s easy to love you when you’re popular. The optics click, everyone prospers.” / „Es ist einfach, dich zu lieben, wenn du beliebt bist. Die Optik stimmt, jeder profitiert.” Wobei die Songs sich immer noch sehr voneinander unterscheiden, was man anhand ihrer Leitmotive erkennt. Die Idee, dass der obsessive Hass eigentlich romantisch ist vs. dass, jede weibliche Celebrity an einem Punkt das Opfer einer Hexenjagd war und Frauen aus diesem Milieu durch diese geteilten Erfahrungen tiefere Freundschaften miteinander pflegen.
Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, jedes einzelne Lied zu analysieren und zu untersuchen, wie sie miteinander sowie mit dem übergeordneten Thema verbunden sind. Der Einfachheit halber werde ich jedoch nur die Lieder „Elizabeth Taylor“, „Ruin the Friendship“ und „CANCELLED!“ als Stichproben nehmen, um meine Sichtweise des Albums zu veranschaulichen. Letzteres wurde bereits ausreichend analysiert. Hingegen wurde „Ruin the Friendship“ bisher ignoriert, obwohl es ein emotionales Highlight ist. Das Lied reflektiert das Bedauern, romantische Gefühle gegenüber einem engen Schulfreund nicht ausgedrückt zu haben, der sich später das Leben genommen hat. Die Liedtexte schildern das Zögern des lyrischen Ichs, auf ihre Gefühle zu reagieren und gipfeln in der bewegenden Offenbarung vom Tod des Freundes und dem innigen Wunsch, dass sie die Gelegenheit ergriffen hätte, ihn geküsst zu haben. Hingegen führt uns der Song „Elizabeth Taylor“ hinter die Bühne des Showlebens einer erwachsenen Frau. Die Texte drücken Bewunderung für die legendäre Schauspielerin aus, um Themen wie Ruhm, Sehnsucht und Einsamkeit zu erkunden.
Die Lieder wirken ziemlich zusammenhangslos, aber es gibt einen roten Faden, dem man hier folgen kann. Das erste Lied handelt von einem trauernden Mädchen, das über ihre flüchtigen Jugendjahre nachdenkt und bedauert, kein Risiko eingegangen zu sein, als sie die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Das zweite Lied handelt von einer jungen Frau, die ihre Ängste über ihren Erfolg äußert und befürchtet, dass ihr Leben (sowohl ihre romantischen Unternehmungen als auch ihr Ruhm) ihr entgleiten wird. Wenn man dies mit dem dritten Lied verbindet, das selbst in den dunkelsten Schluchten des Lebens einer Prominenten Lichtblicke findet, entsteht ein sehr eindrückliches Bild der Botschaft des Albums: Das Leben ist flüchtig. Ebenso die Chancen, die einem geboten werden. Daher sei es besser, ein Risiko einzugehen und mit den Konsequenzen zu leben, als mit der Frage „Was wäre, wenn?“ zu leben.
Ein weiteres Lied, das diese Interpretation bestätigt, ist der Titeltrack „The Life of a Showgirl“. Darin warnt ein Showgirl namens Kitty ein junges Mädchen davor, in ihre Branche einzutreten, und sagt, dass es für jemanden so Gutherzigen wie sie in der Industrie zu brutal sei. Das junge Mädchen nimmt sich die Warnung zu Herzen, beschließt jedoch trotzdem, ihren Träumen zu folgen. Sie singt, dass das Leben eines Showgirls jetzt das Einzige ist, das sie je kennen wird. Kein „Was hätte sein können?“, nur ein „Was meine Situation ist und wie ich damit klarkomme.“
Zynische Zuhörende würden behaupten, dass die übergreifende Botschaft so schlecht vermittelt wird, dass der letzte Song die Message mit der Subtilität eines Megafons übertragen musste. Aber ich würde dieser Meinung widersprechen. Persönlich kam ich auf die ausgelegte Interpretation des Albums während „Wi$h Li$T”, sodass der Titelsong meine Analyse eigentlich nur bestätigte. Gleichzeitig fungiert „The Life of a Showgirl” auch als ein zufriedenstellendes Fazit für das gleichnamige Album.
Angesichts der Schnelligkeit, mit der die letzten Projekte herauskamen, kann ich es niemandem übel nehmen, der denkt, dass ihre Musik mit Plastikkleidern vergleichbar ist, die massenhaft in einer Fabrik produziert werden. Allerdings sind die Lyrics „Did you girlboss too close to the sun?” nur etwas, das eine Person mittleren Alters im Versuch, cool zu wirken, hätte schreiben können. Als Sängerin, Texterin und Regisseurin ist Taylor Swift weiterhin die leitende Kraft hinter all ihren Werken. Demnach fehlt es „The Life of a Showgirl” an vielem, aber an Menschlichkeit definitiv nicht. Und Kunst, die von einem Menschen unperfekt erschaffen wurde, ist es wert, analysiert, kritisiert und seziert zu werden. Kunst, die von einem Unternehmen oder (Gott beschütze uns) einem Roboter gemacht wird, ist völlig wertlos. Daher würde ich es begrüßen, wenn wir als Spezies aufhören würden, das Erstere mit dem Letzteren gleichzusetzen.
Da wir gerade über künstlerische Visionen sprechen: Die Ästhetik des Albums ist, wenn man es etwas übertrieben formulieren will: Atemberaubend. Taylor Swift verkleidet sich als Tänzerin des späten 19. Jahrhunderts. In glitzernden Bikinis, federndem Kopfschmuck und Bühnenkostümen aus verschiedenen Epochen. Aber Swift beschränkt ihre visuellen Darstellungen nicht nur auf Unterhaltungskünstlerinnen in Tanzsälen der 50er-Jahre, die wir als die klassischen Showgirls ansehen würden. Diese Performerinnen werden nämlich nicht nur für ihre Talente, sondern auch für ihr Aussehen bewundert. Also könnten Models, Schauspielerinnen und Popsängerinnen alle in gewissem Sinne als Showgirls betrachtet werden. Siehe das Musikvideo zu „The Fate of Ophelia” für die Art, wie all diese Inspirationen zu einem Fest für die Augen zusammenkommen.
Taylor Swifts neues Projekt hat, ähnlich wie das Leben eines Showgirls selbst, viele Höhen und Tiefen. Swifties, die vor allem Fans von den Alben sind, die das Höchstmaß von Swifts Talent als Liedtexterin zeigten („Speak Now”, „Folklore” und „Evermore”) werden sich mit diesem neuen Projekt wahrscheinlich nicht anfreunden können. Aber der Großteil von Swifts Fanbase scheint sehr zufrieden mit dem Album zu sein. Während der Kinopremiere von „The Life of a Showgirl” konnte man nach jedem Song donnernden Applaus hören. Wie das Publikum bei einem Kabarett, oder Fußballfans in der lokalen Sportkneipe.
6/10 — Ich geh jetzt weiter „Elizabeth Taylor” auf Dauerschleife hören.
Die Quellen:
1. r/TaylorSwift: ‘We need to talk about WOOD’
2. Eagle-Eyed Fans Spot Possible Easter Egg That Suggests Taylor Swift Told a Lie on ‘New Heights’
3. @taypurrswift post from TikTok archived by @taylorssthread on Instagram: ‘a deepdive into WOOD’
4. Urban Dictionary: ‘Girl-bossed a little too close to the sun’
5. Taylor Swift’s ‘Life of a Showgirl’ Sparks Buzz Over Jack Antonoff’s Absence and Max Martin’s Return
Autor:in
-

Auf JUMA22 will ich unsere Leserinnen informieren, unterhalten und dazu animieren, meine Lieblingsfilme zu schauen.
Alle Beiträge ansehen