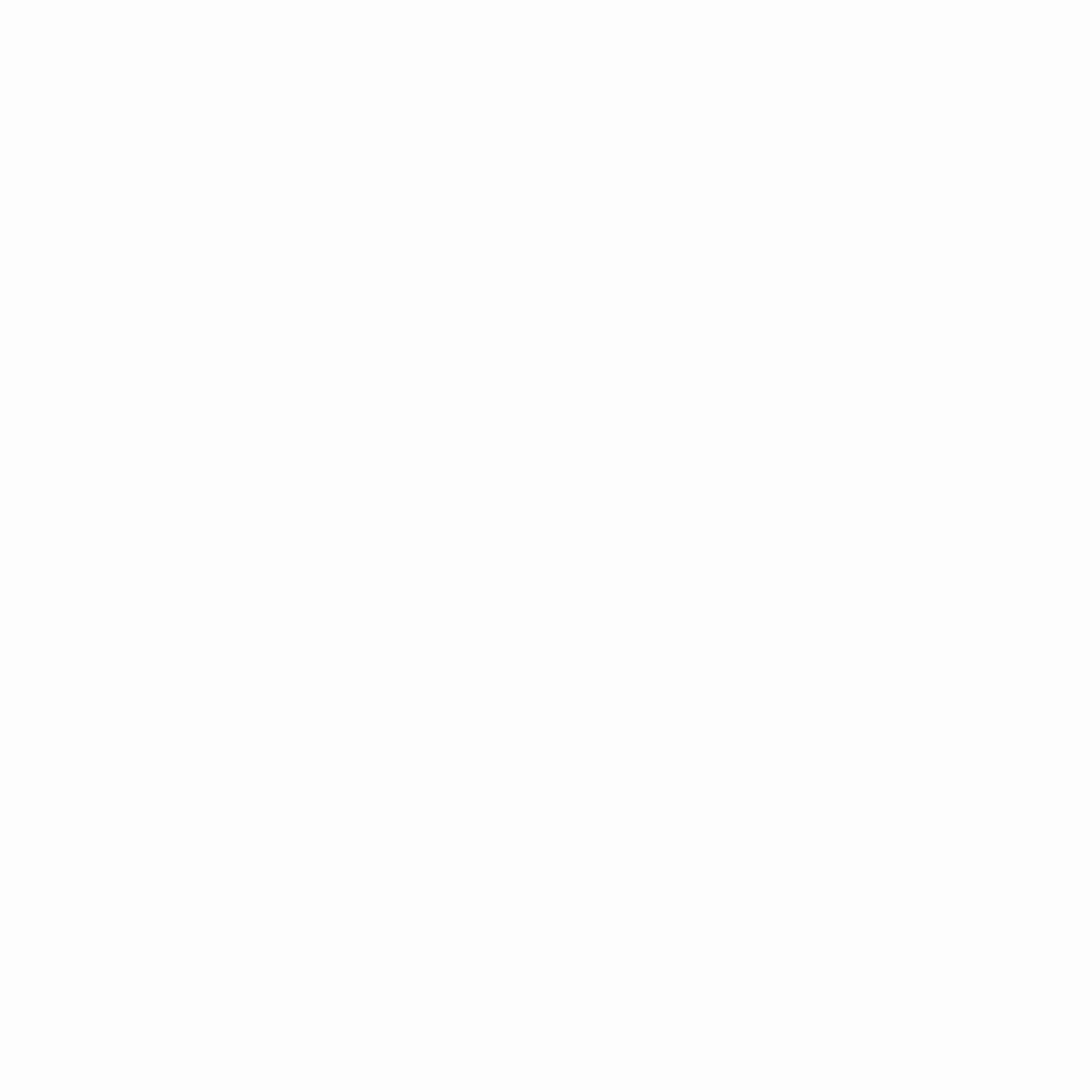Hinweis: Die Quellen, die in diesem Beitrag verwendet wurden, können uns einen Einblick in die damalige Zeit geben. Allerdings sollten diese immer noch mit einem kritischen Auge analysiert werden. Sehr viele Ausdrucksweisen, die in dieser Literatur genutzt werden, sind äußert veraltet. Darüber hinaus sind die Inhalte nicht für Menschen unter 15 Jahren geeignet. Falls Sie sich eine der genannten Quellen näher anschauen wollen, sollten Sie dies mit Vorsicht tun.
Einleitung: In ihrem 1928 erschienenen Song „Prove it on me Blues” singt die Jazzsängerin „Ma Rainey” über einen chaotischen Abend in einer Bar, die sie öfters besucht, um mit den netten Damen zu flirten. (1). „It’s true I wear a collar and a tie, […] Wear my clothes just like a fan. Talk to the gals just like any old man” / „Es ist wahr, ich trage eine Krawatte zu der Bar, […] Trage meine Kleidung wie ein Fan. Spreche mit den Damen wie jeder andere alte Mann.”
Während Rainey in ihren Liedern zuvor auf ihre Beziehungen zu Frauen angespielt hat, singt sie in ihrem Song „Prove it on me Blues” am offensten über ihre Bisexualität und Vorliebe für Frauen. Angesichts der Zeit, in der sie lebte, würde man denken, dass dies gefährlich wäre. Der Hauptpunkt des Liedes ist jedoch, dass die Menschen um sie herum, obwohl es offensichtlich ist, dass sie auf Frauen steht, es tatsächlich nicht schaffen, dies zu beweisen. „They say I do it, ain’t nobody caught me. Sure got to prove it on me!”. / „Sie sagen, ich wäre schuldig, aber niemand hat mich erwischt. Ihr müsst es erstmal beweisen!” Jedoch wird dieser Song noch interessanter in einem queer-historischen Kontext.
Hauptteil: In der Geschichte ergaben sich für die lesbische Community in den USA immer wieder Gelegenheiten, homofeindlicher Gesetze durch bestimmte technische Feinheiten zu entgehen. Ein Beispiel dafür lässt sich in dem Buch „Gender, Sexuality and the Law” finden (2). Die Autorin Mary R. Ziegler schreibt, dass viele homofeindliche Gesetze auf die religiöse Sünde der sogenannten „Sodomie” zurückgehen. (Kontext für Lesende, die das Wort nicht kennen: Sodomie ist ein altertümlicher Begriff, der verschiedene „widernatürliche” sexuelle Praktiken bezeichnet. Das Konzept der „Sodomie” wurde oft von der Kirche benutzt, um Homosexuelle zu diskriminieren). Damals bezog sich die Definition des Begriffes auf sexuelle Handlungen, die nicht zur Fortpflanzung dienten. Viele Menschen dachten, dass Frauen solche Handlungen nicht vollziehen könnten. Jedenfalls nicht ohne die Hilfe eines Mannes. Demnach konnten sexuelle Handlungen zwischen Frauen nicht unter dieses Gesetz fallen und waren demnach nicht illegal.
Ein weiteres Beispiel wäre die „Three-Item-Rule” (auf Deutsch: „Drei-Stück-Regel”), die besagt, dass mindestens drei Kleidungsstücke getragen werden müssen, die das Geschlecht des Trägers oder der Trägerin widerspiegelten (3). Nun, theoretisch umfasste diese Vorschrift sowohl Frauen als auch Männer. In der Praxis jedoch lässt sich maskuline Kleidung leicht über femininen Kleidern tragen. Zum Beispiel, indem man ein Sakko über eine Damenbluse anzieht. Dieses Schlupfloch kann sehr praktisch für Butches sein. Demnach konnten Butch-Frauen in maskuliner Kleidung auftreten, ohne gesetzlich belangt zu werden. (Kontext, für die, die mit diesem Wort nichts anfangen können: „Butch” ist ein amerikanischer Begriff, der eine maskuline lesbische Frau beschreiben kann. Obwohl der Begriff ursprünglich in der lesbischen Bar-Szene entstand, wird er heute auch von anderen Teilen der LGBT+ Community verwendet. Butch-Frauen spielten eine große Rolle in der damaligen Barkultur. Unter anderem, weil sie oft Türsteherinnen für queere Bars waren).
Wegen der beschriebenen Gründe entstanden einige Schlupflöcher, die es lesbischen und bisexuellen Frauen in Amerika erlaubte, dem Griff des Gesetzes zu entkommen.
Jedoch in den späten sechziger Jahren begannen amerikanische Politiker die florierende queere Community in ihrem Land als ein wachsendes Problem anzusehen. Ein Problem, das sie durch die Verschärfung von legalen Maßnahmen lösen wollten. So begann die Polizei härter durchzugreifen. Sie überfielen queere Bars mit zunehmender Häufigkeit. Diese Razzien beinhalteten oft das Durchsuchen der Gäste vor Ort, manchmal das Durchsuchen des Gebäudes und die Festnahme von queeren Menschen wegen Verstößen gegen die zuvor genannten Gesetze: Beteiligung an „homosexuellem Verhalten”, „Nichteinhaltung von geschlechtsspezifischer Kleidung” und ähnlichen Vorwürfen.
In dem Podcast „Made It Out” erzählte die lesbische Aktivistin Lea DeLaria von der brutalen Art und Weise, in der vor allem Butches und Trans-Individuen von den Polizisten behandelt wurden. Auch beschreibt sie, wie sie selbst oft Gewalt von den Polizeibeamten erfuhr (4). Dies malt das Bild einer Polizeibehörde, die Menschen wegen Nichtigkeiten einsperrte, während sie selbst Gesetze brach, die Gefangene schützen sollten.
Im Jahr 1969 gab es einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der LGBT+ Bewegung. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 stürmte die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn im Stadtteil Greenwich Village. Es heißt, dass dabei eine Sängerin von der Polizei aus dem Lokal gezerrt wurde und dabei den anderen Gästen zurief: „Warum tut ihr denn nichts?” (5). Dieser Satz habe die Menge ermutigt, gegen die Festnahmen durch die Polizei zu kämpfen. Die Geschichte über die Sängerin wird häufig erzählt, ist jedoch nicht eindeutig belegt.
Wer die Sängerin gewesen sein soll, die den Aufstand gegen die Polizei begann, ist heute schwer zu sagen. Wenn Spekulationen zu glauben sind, ginge es bei der Sängerin um die Butch-Ikone Stormé DeLarverie (5). Alles, was in dieser Nacht erreicht wurde, kann jedoch nicht nur einer Person zugeschrieben werden. Ein solcher sozialer Fortschritt ist immer die Leistung einer Gruppe.
Der Aufstand, der an diesem Tag ausbrach, ist das, was wir heute die “Stonewall Riots” nennen. Diese Proteste werden oft als bedeutende Vorläufer des heutigen queeren Aktivismus angesehen. Der Grund warum wir jeden Sommer “Pride” feiern ist, (unter anderem) um an die ersten Kämpfe für queere Rechte zu erinnern. Selbst der deutsche Begriff “CSD” (kurz für “Christopher Street Day”), kann auf die “Stonewall Riots” zurückzuführen werden, weil der Aufstand in der Christopher Street stattfand.
Fazit: Diese Schnappschüsse der amerikanischen Geschichte zeigen sehr schön, wie sexuelle Minderheiten menschenfeindliche Gesetze umgingen und Widerstand gegen Polizeigewalt leisteten. Obwohl momentan die Zukunft für die LGBT+ Community düster aussieht, ist es wichtig, Hoffnung zu pflegen. Trotz der homofeindlichen Gesetze, haben queere Menschen schon immer existiert und werden es auch weiterhin tun.
Autor:in
-

Auf JUMA22 will ich unsere Leserinnen informieren, unterhalten und dazu animieren, meine Lieblingsfilme zu schauen.
Alle Beiträge ansehen